Der Herbst ist in vielen Unternehmen die Zeit der Mitarbeiter*innengespräche. Führungskräfte und Mitarbeitende blicken gemeinsam nach vorn: Welche Schwerpunkte stehen im kommenden Jahr an? Welche Ergebnisse sollen erreicht werden? Welche Entwicklung ist wichtig?
Oft laufen diese Gespräche routiniert ab. Zahlen werden eingetragen, Projekte benannt, Kennzahlen festgelegt. Doch manchmal zeigt sich in einem kleinen Moment, worum es eigentlich geht.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Führungskraft. Sie hatte mit ihrem Team ehrgeizige Ziele definiert. Als ein Mitarbeiter nachfragte, warum ein bestimmtes Projekt überhaupt Priorität habe, rutschte ihr beinahe heraus: „Weil ich es sage.“ Sie hielt inne – und merkte, dass genau hier der Knackpunkt lag. Dieses „Warum“ führte sie in die Sackgasse der Rechtfertigung. Also drehte sie die Perspektive: „Wozu machen wir das? Damit unsere Kund*innen ihre Anfragen schneller bearbeitet bekommen – und wir Zeit gewinnen, uns auf die komplexeren Themen zu konzentrieren.“ In diesem Moment kippte die Stimmung. Aus Pflicht wurde Sinn, aus Widerstand Motivation.
Genau hier setzt die Coverdale-Zielscheibe an.
In der Zieldefinition spielt der Zweck eine große Rolle. Wir unterscheiden den
- operativen Zweck – wozu dient das konkrete Endergebnis und den
- strategischen Zweck – wozu trägt dieses Ergebnis im größeren Ganzen bei. Doch damit ist es nicht getan.
Drei weitere Fragen machen die Definition vollständig:
- Für wen ist das Ziel wichtig?
- Was genau soll erreicht sein?
- Woran messen wir, dass es gelungen ist?
Erst wenn diese vier Fragen beantwortet sind – Wozu, Für wen, Was und Woran messen wir Erfolg – entsteht ein vollständiges Zielbild.
Genau hier kommt die Sprache ins Spiel
In der Praxis werden „Warum“ und „Wozu“ gern synonym verwendet – doch der Unterschied ist entscheidend.
- „Warum“ schaut zurück: es sucht nach Gründen, manchmal auch nach Schuld.
- „Wozu“ hingegen öffnet den Blick nach vorn: es zeigt Nutzen, Wirkung und Sinn.
Wer in Zielgesprächen „Warum“ mit „Wozu“ verwechselt, landet schnell bei Rechtfertigungen. Wer aber „Wozu“ fragt, eröffnet Perspektive. Und dann gibt es da noch das bekannte „Warum ich?“. Meist ist es kein echtes Interesse, sondern ein verkapptes „Ich will das nicht.“ Führungskräfte, die hier in lange Erklärungen gehen, verstricken sich leicht. Hilfreicher ist es, dass „Warum“ in ein „Wozu“ zu übersetzen und den Zweck zu erklären, statt sich in Verteidigungen zu verlieren.
Vielleicht ist das der wichtigste Tipp: Hören Sie in Mitarbeitergesprächen „Warum“ öfter als „Wozu“. Reagieren Sie mit Zukunftsbildern, statt mit Begründungen. So entstehen Gespräche, die motivieren, statt zu bremsen.
Gerade jetzt, wo vielerorts die MAGs anstehen, lohnt es sich, diesen Unterschied bewusst zu machen. Denn Zielvereinbarungsgespräche sind weit mehr als ein Pflichttermin im Kalender. Sie sind eine Chance, Sinn zu stiften, Orientierung zu geben und Engagement zu fördern.
Führung wird dort wirksam, wo sie Klarheit schafft, und Sinn vermittelt. Wenn wir Ziele nicht nur festlegen, sondern mit den vier Fragen der Zielscheibe durchdenken – und wenn wir bewusst zwischen „Warum“ und „Wozu“ unterscheiden – dann werden aus Vereinbarungen keine trockenen Pflichten, sondern verbindende Versprechen.
Und vielleicht lohnt es sich genau jetzt, in dieser Zeit der Gespräche, einmal mehr zu fragen: 👉 Wozu tun wir das eigentlich?

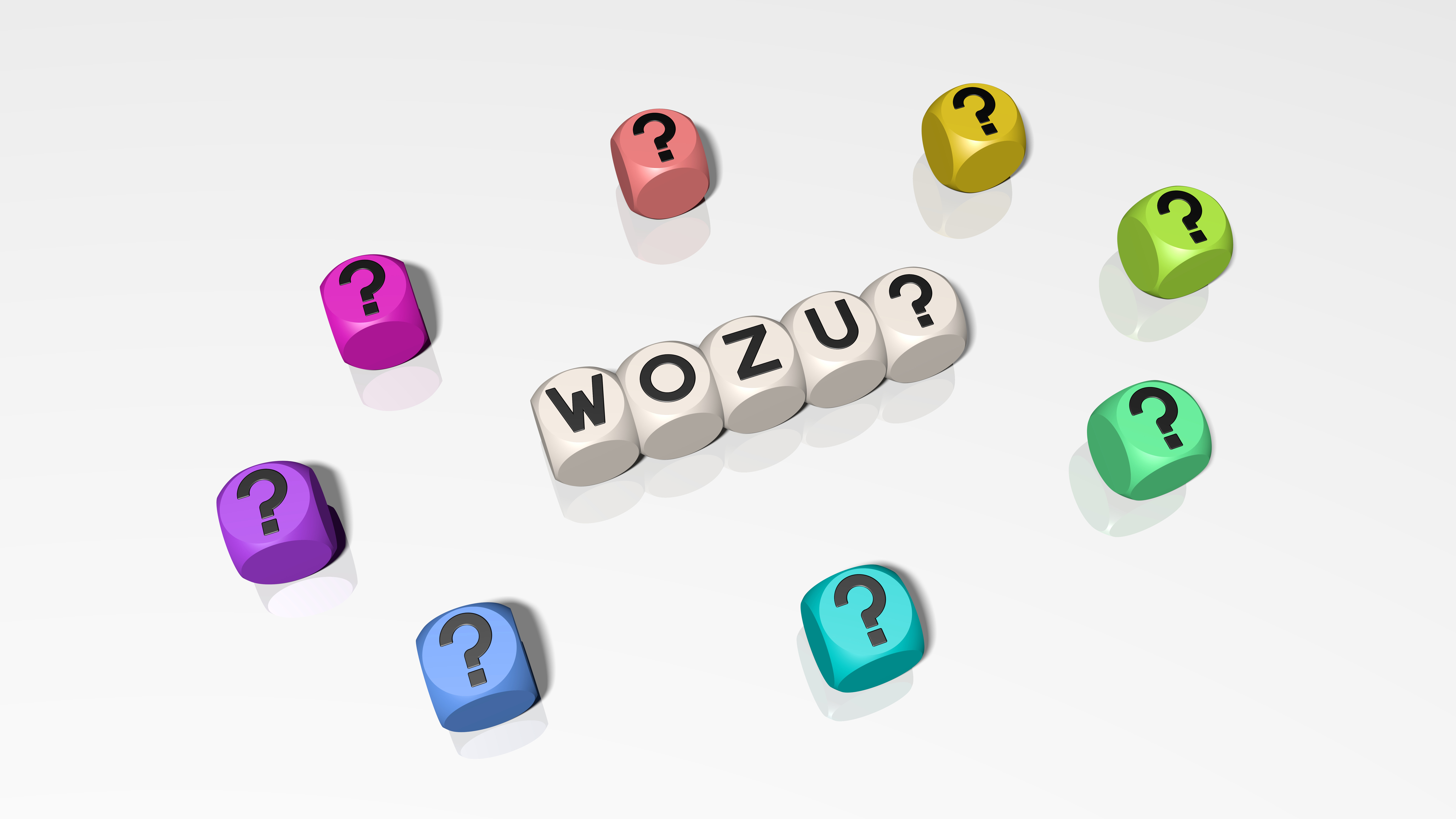
Recent Comments